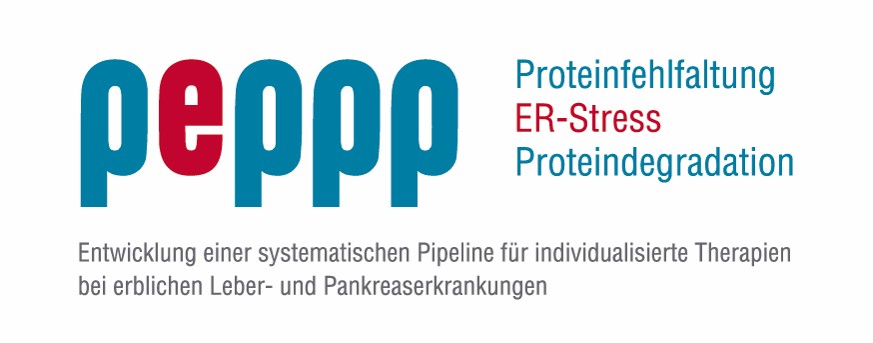Woran starb eigentlich Beethoven? Oder Lenin? Und wie sicher konnten Todesursachen früher überhaupt festgestellt werden? Diese und andere Fragen beantworten die Mitarbeiter des Instituts für Pathologie der Rostocker Universitätsmedizin: Bei der Langen Nacht der Wissenschaften am 17. Mai geben sie einen Einblick in die Leiden berühmter Persönlichkeiten.
Paula Röpenack schließt die schwere Tür im obersten Geschoss des Pathologie-Gebäudes auf. Rund 1000 Präparate von Lungen, Nieren und anderen Organen verbergen sich hier. „Die meisten stammen aus den 50er, 60er Jahren“, erklärt die Medizinstudentin, die seit zwei Jahren als studentische Mitarbeiterin am Institut mitwirkt. „Das älteste ist von 1889.“ Die in Formalin eingelegten Präparate werden vorrangig für die Lehre eingesetzt. „Irgendwann wollen wir hier auch Führungen anbieten.“ Einige Objekte zeigt die 24-Jährige am 17. Mai: Anhand neun berühmter Patienten stellt sie verschiedene Krankheitsbilder vor und zeigt exemplarische Präparate.
Das Wissen über die Todesursachen liefern verschiedene Quellen: „Ein wahres Mosaik aus Büchern, Sektionsprotokollen und Briefen“, sagt Röpenack. „Sichere Diagnosen wurden damals kaum getroffen. Heute schauen wir also, welche Krankheit am ehesten zu den beschriebenen Symptomen passt.“ Der Weisheit letzten Schluss sollten die Besucher nicht erwarten – allein zu Mozarts Tod gibt es über 150 verschiedene Diagnosen.
Eine nicht einfache, aber interessante Arbeit, findet die Studentin, die derzeit an ihrer Doktorarbeit schreibt: „Spannend zu entdecken, welchen Einfluss Krankheiten im Laufe der Geschichte hatten“, sagt sie mit leuchtenden Augen. „Lenin war das letzte Jahr aufgrund seiner Krankheit nicht mehr in der Lage zu regieren. Stalin hatte leichtes Spiel.“ Auch Ignaz Semmelweis, der einst das Kindbettfieber durch Händewaschen eindämmte, konnte seinen Ruhm nicht ernten: „Tragisch“, so Röpenack. „Durch seine Krankheit litt er an Wutanfällen und verlor seinen Intellekt. Am Ende bekam er keine Fakten mehr zusammen.“
Seit Semmelweis‘ Zeiten habe sich die Pathologie stark weiterentwickelt, räumt Prof. Dr. Erbersdobler, Leiter des Instituts für Pathologie, ein. „Durch Rudolf Virchow und die Einführung der mikroskopischen Pathologie erkennen wir heute weit mehr als das, was mit dem bloßen Auge sichtbar ist.“ Unter Erbersdoblers Federführung war die Rostocker Pathologie im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei der Langen Nacht dabei – und sahnte im Kommunikationswettbewerb gleich den ersten Platz ab. Damals sei auch die Idee für die diesjährige Ausstellung entstanden, erzählt Erbersdobler: „2013 ging es um die vergessene Krankheit Tuberkulose, die früher die geläufigste Todesursache war – auch für bekannte Persönlichkeiten, die wir kurz vorgestellt haben.“ Das sei so gut angekommen, dass man das Konzept in diesem Jahr ausgebaut habe.
Und woran sind Lenin, Goethe und Co. nun gestorben? „Wird noch nicht verraten“, sagen Erbersdobler und Röpenack geheimnisvoll. Nur so viel sei gesagt: Mit der Syphilis, die vielen Berühmtheiten angedichtet wird, hat man manchen oft einfach nur den Ruf verderben wollen.
Lange Nacht der Wissenschaften: 17. Mai ab 16 Uhr; spannende Stationen auf dem Gelände der Uni und der Universitätsmedizin; Netz: www.lange-nacht-des-wissens.de
Ausstellung „Woran starb eigentlich…“: Institut für Pathologie, Strempelstraße 14, 3. Etage, Konferenzraum (Fahrstuhl vorhanden), durchgängig ab 16 Uhr