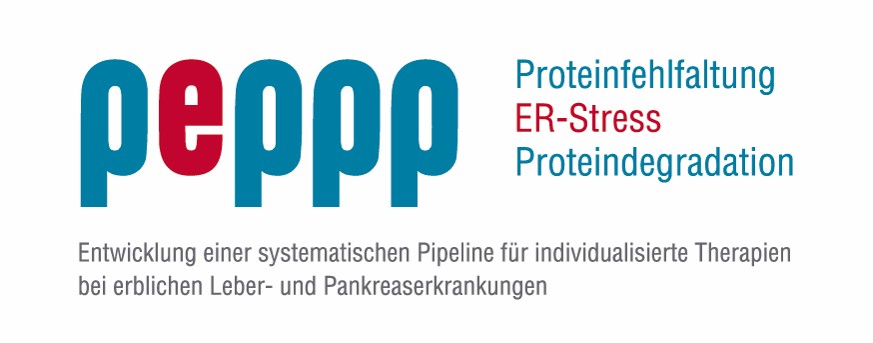Das Projekt Smart Implants for Life Enrichment (SmILE) hat sich das Ziel gesetzt, intelligente Implantat-Lösungen zu entwickeln, um die sozioökonomischen Belastungen durch muskuloskelettale Erkrankungen bei älteren Menschen zu verringern.
Aufgrund des demografischen Wandels rücken muskuloskelettale Erkrankungen stärker ins Blickfeld, da diese besonders ältere Menschen betreffen, unter anderem durch Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Osteoporose und Fragilitätsfrakturen. Letztlich können diese zu chronischen Schmerzen und eingeschränkter Mobilität führen, welche einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität haben.
Da der Anteil älterer Menschen rasant wächst, stellen muskuloskelettale Erkrankungen eine drängende globale Gesundheitsherausforderung dar. Hierfür wurde das SmILE-Projekt unter der Horizon-Europe-Initiative ins Leben gerufen, um Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben. Die Mission des Projekts besteht darin, intelligente Implantat-Lösungen für die Intervention bei muskuloskelettalen Erkrankungen zu entwickeln, um Patienten zu befähigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und gleichzeitig die Belastung der Gesundheitssysteme zu verringern.
Im Mittelpunkt des SmILE-Projekts steht die Entwicklung einer universellen Chip-Plattform, die in eine Vielzahl von medizinischen Implantaten integriert werden kann. Diese Technologie verwandelt bestehende Implantate in aktive Datengeneratoren, wodurch eine schnellere und genauere Diagnosestellung ermöglicht und die Einführung innovativer Behandlungen unterstützt wird.
Die gesammelten Daten werden über eine integrierte, patientenzentrierte Gesundheitsplattform verarbeitet, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Nutzer zugeschnitten ist. Diese Plattform ermöglicht es den Patienten und Patientinnen, einen umfassenden Überblick über ihren Gesundheitsstatus zu erhalten, maßgeschneiderte Empfehlungen zu bekommen und ihre Erkrankung aktiv zu überwachen. Zusätzlich wird die Plattform von einem KI-gestützten Datensystem unterstützt, welches persönliche Patientendaten mit Informationen aus verschiedenen Quellen wie Implantaten, tragbaren Geräten und Gesundheitsfragebögen kombiniert.
Durch den Einsatz modernster digitaler Werkzeuge verbessert das Projekt die Autonomie und Unabhängigkeit älterer Menschen und bietet neue Möglichkeiten Gesundheitsparameter zu überwachen. Über die gesundheitlichen Vorteile hinaus trägt das Projekt zur sozialen Inklusion bei, indem es ältere Bevölkerungsgruppen ins Zentrum digitaler Innovationen im Gesundheitswesen rückt. Darüber hinaus fördert das Projekt durch die Nutzung digitaler Gesundheitsplattformen Stereotype über die digitale Kompetenz älterer Menschen.
Das SmILE Projekt wird im Rahmen des Horizon-Europe-Programms der Europäischen Union sowie durch das Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SERI) mit einem Budget von insgesamt 20,7 Millionen Euro unterstützt. Es erstreckt sich über einen Zeitraum von 60 Monaten und vereint 25 renommierte Partnereinrichtungen aus Wissenschaft und Industrie aus 11 europäischen Ländern.
An der Universitätsmedizin Rostock wird das Projekt durch das Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie (FORBIOMIT) an der Orthopädischen Klinik und Poliklinik unter Leitung von Prof. Dr. Rainer Bader, Prof. Dr. Martin Ellenrieder und Dr.-Ing. Märuan Kebbach und an der Universität Rostock durch das Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Christian Haubelt und Dr.-Ing. Florian Grützmacher bearbeitet. In Rostock wird das Projekt zudem von der Fa. Innoproof GmbH unter Leitung von PD Dr.-Ing. Daniel Klüß unterstützt. Die Rostocker Einrichtungen arbeiten in den nächsten Jahren eng mit den europäischen Projektpartnern zusammen, um die Entwicklung intelligenter Hüft- und Knieendoprothesen mit verschiedenen Sensorfunktionen voranzutreiben, wobei computergestützte und experimentelle Untersuchungen an generierten Labormustern und Funktionsdemonstratoren durchgeführt werden. Das SmILE Projekt knüpft dabei an von den Rostocker Partnern im Rahmen des Sonderforschungsbereichs ELAINE 1270/1,2 durchgeführte Grundlagenforschungsarbeiten an.
Mehr Informationen gibt es hier.